Umweltprojekt Blockheizkraftwerk
Der Ausstieg aus der Atomenergienutzung ist möglich
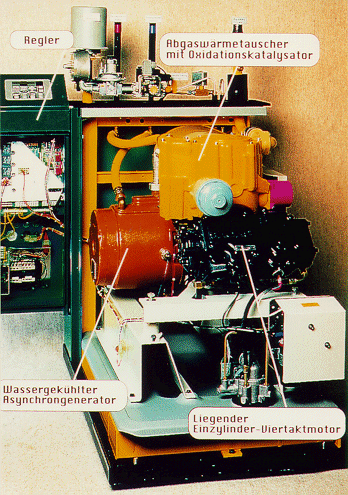
Energieverbrauch stagniert: Der derzeitige Primärenergieverbrauch stützt sich im wesentlichen auf Mineralöl (41,4 %), Steinkohle (15 %), Braunkohle (14,2 %), Erdgas (16,5 %) und Atomenergie (10,6 %). Die noch in den siebziger Jahren prophezeite Verdoppelung des Verbrauchs bis zum Jahr 2 000 hat sich nicht bewahrheitet. Im Gegenteil: der Energieverbrauch schwankt zwischen Rückgang und Stagnation. Seit 1984 ist kein neues Atomkraftwerk mehr ans Netz gegangen. Es gibt keinen Bedarf für diese politisch umstrittene und kostspielige Energieerzeugung.
Thema der Energiekonsensgespräche ist zwar die Aushandlung von möglichst langen Restlaufzeiten der AKW. Aber selbst mit der Forderung nach dem berüchtigten Fadenrißverhinderungsreaktor traut sich keiner so recht einen wesentlichen Zubau zu fordern. Ein drängendes Problem bei der Energieerzeugung sind bekanntlich auch CO2-Emissionen, die für den Treibhauseffekt mitverantwortlich sind. Daher geht es in Zukunft nicht nur um den Ausstieg aus der Atomenergienutzung, sondern auch noch um die Verringerung von anderen Schadstoffemissionen außer der Radioaktivität.
Zahlreiche Szenarien und Berechnungen ökologisch orientierter Institute zeichnen inzwischen den Weg, der in diese Richtung führt. Der naheliegendste und wirkungsvollste Schritt kann durch Energieeinsparung und Effizienzsteigerung getan werden. Man bedenke z. B. , dass die Hauptlieferanten von Strom für das europäische Verbundnetz, die großen Kohle- und Atomkraftwerke, nur einen elektrischen Wirkungsgrad von ca. 35 % haben. 65 % der erzeugten Energie müssen als Abwärme nutzlos abgegeben werden. Diese Giganten liegen ja zum Teil aus guten Sicherheitsgründen sehr weit weg von potentiellen Heizenergieverbrauchern.
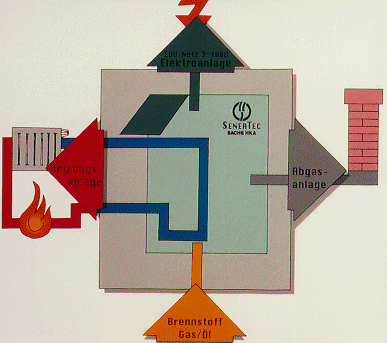
Eine Effizienzsteigerung in Form von Wärme-Kraftkoppelung wird in Zukunft nicht mit thermischen Großkraftwerken zu erreichen sein. Ein Nah- und Fernwärmenetz macht nur in effektiver Nähe zu den Verbrauchern Sinn. Da der Energieverbrauch für Wärme bei uns in Deutschland mit 60 % zu Buche schlägt, liegt hier ein weites Feld zu Einsparungen ohne Einschränkungen für den Verbraucher. Im Gegenteil: Die Nutzung von Abfallwärme verspricht preiswerten Komfort.
In Blockheizkraftwerken (BHKW) wird elektrischer Strom mit Hilfe eines Gas- oder Dieselmotors erzeugt. Nachwachsende Energieträger wie Pflanzenöl oder Methan aus Biogasanlagen, aber auch Deponie- und Klärgas können dafür verwendet werden. Bei BHKW's wird, vergleichbar zur Heizung in Autos, die beim Betrieb des Motors anfallende Wärme zu Heizzwecken und zur Warmwasserbereitung genutzt. Moderne BHKW erreichen einen Gesamtwirkungsgrad von 90 %. Das ist nicht nur eine erhebliche Effizienzsteigerung, darüber hinaus entsteht für die Erzeugung der Wärme keine zusätzliche CO2 Emission.
Wenn man alle Folgekosten der derzeitigen Energieversorgung, wie Umweltschäden, umweltbedingte Krankheiten, Katastrophen und die Entsorgung des Atommülls berücksichtigt, ist eine dezentrale Energieversorgung auch wirtschaftlich wesentlich günstiger. Die Säulen einer zukünftigen umweltverträglichen dezentralen Energieversorgung werden daher folgerichtig Energieeinsparung, Effizienzsteigerung und Einsatz erneuerbarer Energiequellen sein.
Herzstück der Sachs HKA ist ein Einzylinder-Spezialmotor, der ausschließlich für diesen Einsatzzweck entwickelt wurde. In der Praxis erreicht er eine Betriebsdauer von über 80.000 Stunden, was der Fahrleistung eines PKW's von ca. 4 bis 5 Millionen Kilometern entspricht.
Als Brennstoffe kommen Erdgas, Flüssiggas, Heizöl und in Zukunft auch Bio-Gase zum Einsatz. Der Motor ist direkt an einen Asynchron-Spezial-Generator gekoppelt, der elektrische Leistung erzeugt. Dabei entstehen gleichzeitig 12,5 kW Wärme (Gas) bzw. 11,0 kW Wärme (Heizöl). Diese wird direkt in das Heiz- und Brauchwassersystem eines Gebäudes abgegeben. Der Strom wird primär im Gebäude selbst genutzt; überschüssiger Strom fließt in das öffentliche Netz.
| Brennstoff | elektrische Leistung | thermische Leistung (ohne AWT) |
| Erdgas | 5,5 kW | 12,5 kW |
| Flüssiggas | 5,5 kW | 12,5 kW |
| Heizöl EL | 5,0 kW | 11,0 kW |
In Verbindung mit einem zusätzlichem Abgaswärmetauscher (AWT) kann die thermische Leistung um 1 bis 3 kW gesteigert werden.
Ein Mikroprozessor übernimmt die Regelung der Sachs HKA. Hier sind alle Überwachungs- und Netzsicherheitsfunktionen integriert, die deutsche Elektroversorger fordern und einen sicheren Dauerbetrieb garantieren.
Die Sachs HKA wird wie ein moderner Heizkessel installiert und zusammen mit einem Heizkessel betrieben (bivalenter Betrieb).
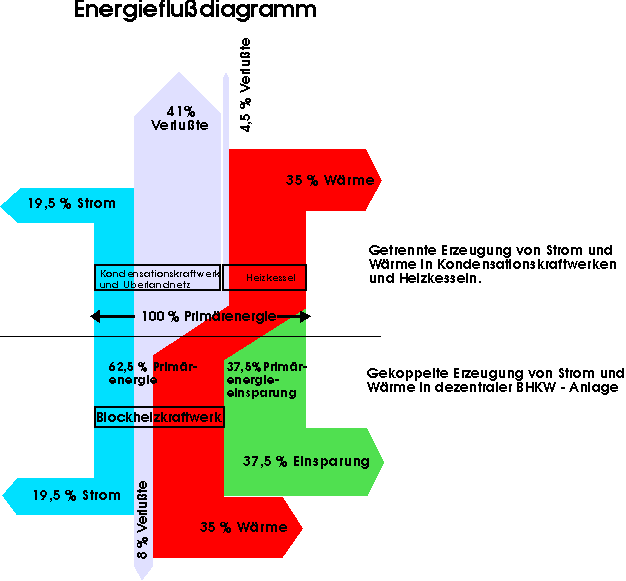
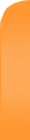





 Holzvergasung
Holzvergasung